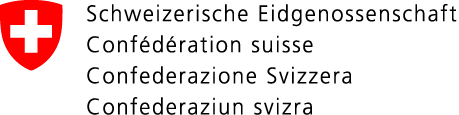Im appenzellischen Trogen entsteht ab 1946 das Kinderdorf Pestalozzi – ein prominentes Beispiel einer jahrhundertealten Bauaufgabe, die kaum im Kanon des baukulturellen Erbes auftaucht. Anlässlich des Jubiläums des Europäischen Denkmalschutzjahrs 1975 erhält das «Erbe von Randgruppen, Minderheiten und Menschen ohne Lobby» eine Plattform.
Von Kathrin Gurtner

Im Jahr 1972 lanciert der Europarat die Kampagne «Europäisches Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975». Unter dem Motto „Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“ werden Grundlagen geschaffen, die den Schutz des baulichen Erbes erleichtern und die Öffentlichkeit für die vielschichtigen Werte von historischen Gebäuden und Ortsbildern sensibilisieren sollen.
50 Jahre später stellt sich die Frage in einer zunehmend diversen Gesellschaft neu: «Eine Zukunft für wessen Vergangenheit? Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby». Mit dem gegenüber 1975 bewusst veränderten Motto werden bauliche Zeugen in den Fokus gerückt, die bisher kaum Teil der offiziellen Erinnerungskultur waren. Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für den Schutz des Erbes von Minderheiten ist zwar in den Leitsätzen zur Denkmalpflege von 2007 festgeschrieben, in den bestehenden schweizerischen Inventarwerken ist das aber nur bedingt ablesbar. Dies bestätigt sich auch bei Recherchen im Eidgenössischen Archiv für Denkmalpflege. Während eindrucksvolle Kirchenbauten, Regierungsgebäude und archäologische Grabungen gut dokumentiert sind, finden sich kaum Hinweise zu Kinderheimen und anderen Gebäuden für «Menschen ohne Lobby». Dabei sind Kinderheime über Jahrhunderte hinweg Teil eines umfassenden Fürsorgesystems und wirken sich in ihrer baulichen Ausgestaltung prägend auf die betroffenen Kinder aus.
Kinderheime als Spiegel gesellschaftlicher Überzeugungen

Die frühesten Kinderheime oder Waisenhäuser im 17. und 18. Jahrhundert sind grosse repräsentative Gebäude, die an prominenter Lage in Städten und Dörfern platziert werden. Stilistisch verwandte, schlossähnliche Gebäude in barocken Formen finden sich etwa in Bern, Zürich und St. Gallen. Sie dienen gleichzeitig zur «Bewahrung» von Waisenkindern wie auch von Armen und Straffälligen. Auf die Bedürfnisse und Proportionen von Kindern wird bei der Gestaltung kaum geachtet, viel mehr zählt die Zurschaustellung von Stärke und Macht der Behörden.

Im Lauf des 19. Jahrhunderts entwickelt sich ein wahrer Boom von Anstaltsgründungen, meist karitativ oder religiös motiviert. Der bevorzugte Standort wechselt aus dem Stadtgefüge hinaus aufs Land. Nebst Waisen- und Armenhäusern entstehen so genannte Rettungsanstalten, deren Ziel die Erziehung und «Rettung» von «verwahrlosten» Kindern ist. Wenn möglich mieten sich die Rettunganstalten in bestehende Gebäude wie Bauernhäuser und Klöster ein, die sie ihren Bedürfnissen entsprechend umbauen. Werden die Gebäude neu erstellt, widerspiegelt die Architektur das pädagogische Konzept von Disziplin und Ordnung.
Von der Anstalt zum Lebensraum

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzen mit der Reformpädagogik erste Veränderungen in Richtung kindergerechter Architektur ein. Auch wenn die Gebäude in ihren Dimensionen weiterhin imposant bleiben, wirken sie einladender. Überschaubare Abteilungen sorgen für eine gewisse Differenzierung: die Kinder werden nun nach Alter und Geschlecht getrennt untergebracht. Oft sind die Anstalten ergänzt durch landwirtschaftliche Betriebe, in denen die Kinder hart arbeiten.
Obwohl seit den 1920er Jahren immer wieder Kritik an den kinderfeindlichen Lebensumständen in vielen Anstalten geübt wird, beginnt sich erst nach dem 2. Weltkrieg ein neues Ideal durchzusetzen. Das Kinderheim soll nun nicht mehr Ort der Verwahrung sein, sondern tatsächlich ein «Heim»; ein Wohnort, an dem sich Kinder zuhause fühlen können. Anstelle riesiger, anonymer Gebäude entstehen kleinere, freundliche Gebäude. In der Raumaufteilung wird Wert auf Licht, Farbe und Wohnlichkeit gelegt. Die Aussenräume bieten Platz zum Spielen.
Das Kinderdorf Pestalozzi

Ein Musterbeispiel für kindergerechte Bauweise ist das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen, das 1946 für kriegstraumatisierte Kinder aus ganz Europa gegründet wird. Der Architekt Hans Fischli (1909-1989) bedient sich für das Kinderdorf der regionalen ländlichen Architektur, obwohl er sich vorher mit kubistischen Bauten im Bauhausstil einen Namen gemacht hat. Die Wohnhäuser fügen sich harmonisch in die Landschaft ein und schaffen so eine Atmosphäre von Geborgenheit und Normalität.
In den Häusern leben die Kinder und ihre Erzieherinnen und Erzieher aus dem gleichen Land in familienähnlihchen Strukturen, fügen sich in die Appenzeller Landschaft ein und stellen kein Fremdkörper dar. Gleiches erhofft er sich für die Kinder aus aller Welt, für die er ein gemütliches, beschützendes Zuhause plant. Fischli achtet bis ins Detail auf kindergerechte Bauweise, indem er von der Raumaufteilung bis zur Einrichtung auf kindliche Proportionen Rücksicht nimmt. Die Häuser sollen keinesfalls an Erziehungsheime und Anstalten erinnern, sondern den Charakter von normalen Wohnhäusern ausstrahlen.«Ich liebe meine frischen Appenzeller Häuser» äussert sich Fischli nach der Fertigstellung zufrieden. Bis heute wird seine Begeisterung über das Kinderdorf breit geteilt. Sowohl aus architektonischer, wie auch pädagogischer und sozialer Perspektive gilt Fischlis Projekt als Leuchtturmprojekt für die Förderung des friedlichen Zusammenlebens.
Die Kampagne «Europäisches Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975» wird ab 1972 wesentlich vom International Council on Monuments and Sites ICOMOS vorangetrieben. Inhaltlich federführend ist der Schweizer Alfred A. Schmid (1920-2004), Kunstgeschichtsprofessor in Fribourg, langjähriger Präsident der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege EKD sowie Mitglied des Exekutivkomitees des ICOMOS.
Sein umfangreiches Archiv, ebenso wie das Archiv zum Europäischen Denkmaljahr, lagert im Eidgenössischen Archiv für Denkmalpflege in der Schweizerischen Nationalbibliothek.
Literatur und Quellen
- A future for whose past? Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby. Hrsg. AG Denkmalschutzjahr 2025, ICOMOS Suisse, Denkmalpflege der ETH Zürich, Zürich: Hier und Jetzt Verlag, 2025.
- Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz, Hrsg. Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege, Zürich: vdf Hochschulverlag AG, 2007.
- Chmelik, Peter. Armenerziehungs- und Rettungsanstalten: Erziehungsheime für reformierte Kinder im 19. Jahrhundert in der deutschsprachigen Schweiz. Reinach: P. Chmelik, 1986 (Diss. Phil. I, Zürich 1975)
- Aufwachsen ohne Eltern Verdingkinder, Heimkinder, Pflegekinder, Waisenkinder: zur ausserfamiliären Erziehung in der deutschsprachigen Schweiz. Hrsg.: Jürg Schoch, Heinrich Tuggener, Daniel Wehrli, Zürich: Chronos-Verlag, 1989.
Letzte Änderung 29.07.2025
Kontakt
Schweizerische Nationalbibliothek
Graphische Sammlung
Hallwylstrasse 15
3003
Bern
Schweiz
Telefon
+41 58 462 89 71