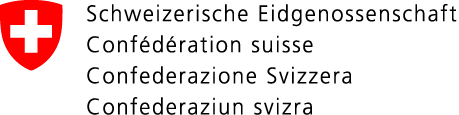Am 1. März feiern viele Menschen in Graubünden den Chalandamarz, ein Fest zum Abschied vom Winter und zum Beginn des Frühlings. Der Name kommt aus dem Rätoromanischen und zeigt, woher der Brauch stammt. Durch das Kinderbuch «Schellen-Ursli» wurde die Tradition auch ausserhalb der Schweiz bekannt.
Fast alle Menschen in der Schweiz kennen den Schellen-Ursli oder Uorsin, wie im rätoromanischen Original. Das Werk aus dem Jahr 1945, geschrieben von Selina Chönz (1910-2000) und illustriert von Alois Carigiet (1902-1985), hat die Kindheit von Generationen geprägt. Die berührende Familiengeschichte mit den eindrücklichen Zeichnungen, welche Einblicke in die rätoromanische Kultur geben, gefällt noch heute.
Die Erlebnisse des Bündner Bergbuben sind mittlerweile auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Neben rätoromanischen und deutschen Ausgaben stehen französische, italienische, englische, chinesische, japanische, schwedische und niederländische Übersetzungen im Bestand der Schweizerischen Nationalbibliothek, wie eine Katalogsuche mit dem Originaltitel «Uorsin» beweist. Es gibt gar Versionen in Esperanto und Persisch!
Das Jahr der Veröffentlichung 1945 passte bestens in die Zeit, welche von Heimatschutz und geistiger Landesverteidigung geprägt war. Zudem war Rätoromanisch mit seinen verschiedenen Dialekten (Idiomen) erst seit 1938 durch eine Volksabstimmung als vierte offizielle Landessprache der Schweiz anerkannt.
Guarda und Chalandamarz für den rätoromanischen «Touch»
Es ist kein Zufall, dass die Geschichte in einem Dorf spielt, das in Carigiets Zeichnungen stark an Guarda erinnert.: Dieses Dorf wurde zwischen 1939 und 1945 vom Bündner Heimatschutz aufwendig restauriert. Chönz lebte dort, und Carigiet verbrachte längere Zeit im Ort. Chönz’ Ehemann, Iachen Ulrich Könz (1899–1980), war als Architekt und Denkmalpfleger des Kantons Graubünden für die Sanierung des gesamten Dorfs verantwortlich.

© Flurin Bertschinger (2015)
Ein weiteres wichtiges Element in der Geschichte ist der Brauch des Chalandamarz. Es gibt zwar regionale Unterschiede, doch ein lärmiger Umzug von Kindern (früher meist bloss von Knaben) in traditioneller regionaler Bauernkleidung (blaues Hemd, rotes Halstuch und oft roter Zipfelmütze) mit Schellen, Glocken, Rätschen, Peitschenknallen und Singen gehört überall dazu. Mit dem Lärm soll der Winter vertrieben und der Frühling eingeläutet werden. Früher wurden am Chalandamarz in vielen Orten auch die Gemeindeämter neu besetzt. Der Brauch steht auf der Liste der lebendigen Traditionen Schweiz. Die Website lebendige-traditionen.ch des Bundesamts für Kultur (BAK) zeigt die Vielfältigkeit des Brauchs auf.
Verbreitung, Ursprünge und Entwicklungen des Brauchs
Der Brauch wird im Engadin, im Münstertal, im Bergell, im Puschlav, im Misox, im Oberhalbstein und im Albulatal begangen. Der Brauch wurde in Celerina fast 200 Jahre lang verboten, weil ein pietistischer Pfarrer im 18. Jahrhundert gegen den für ihn heidnischen Brauch der Wintervertreibung war. Auch wenn der Begriff Chalandamarz (Kalenden des März) auf den altrömischen Jahresanfang verweist, lässt sich dessen Geschichte jedoch nicht so weit zurück belegen.
Gleich wie das Rätoromanische – ursprünglich die vorherrschende Bünder Sprache – verlor der Chalandamarz im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung, besonders in den Gegenden mit wachsendem Fremdenverkehr. Touristiker und Heimatschützer erkannten jedoch den Wert der romanischen Kultur und verhalfen dem Chalandamarz im 20. Jahrhundert zu neuer Bekanntheit und überregionaler Bedeutung. Die rätoromanische Bevölkerung trug dieses Vorhaben gerne mit und besann sich auf ihre kulturellen Wurzeln.
Plötzlich ein Thema für die ganze Schweiz: Der Chalandamarz in der Presse
Eine Recherche in e-newspaperarchives.ch, dem Portal der digitalisierten Schweizer Zeitungen, belegt die bisherigen Aussagen. Stand Januar 2025 sind darin 1387 Artikel mit mehr als 50 Wörtern unter dem Stichwort «Chalandamarz» verzeichnet. Der Löwenanteil von 1202 Beiträgen entfällt dabei auf Bündner Medien, die übrigen stammen aus der restlichen Schweiz. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg finden sich ausserhalb von Graubünden eingehende Schilderungen zum Brauch des Chalandamarz. Man kann also gewissermassen von einem Schellen-Ursli-Effekt sprechen!
Literatur und Quellen
- Chalandamarz. In: Die lebendigen Traditionen der Schweiz. Website des Bundesamts für Kultur (BAK).
- Liste der Ausgaben des «Schellen-Urslis» im Bestand der NB
- Suchergebnisse zum Begriff «Chalandamarz» im Online-Katalog der NB
- Andri Peer. Chalandamarz. In: Die Schweiz = Suisse = Svizzera = Switzerland. Offizielle Reisezeitschrift der Schweiz. Verkehrszentrale, der Schweizerischen Bundesbahnen, Privatbahnen, 1962, Nr. 2, S. 18-19.
- Daniel Kessler. Hotels und Dörfer. Oberengadiner Hotellerie und Bevölkerung in der Zwischenkriegszeit. In: Beiheft zum Bündner Monatsblatt 5 (1997), S. 1-239.
- Simon Bundi. Graubünden und der Heimatschutz. Von der Erfindung der Heimat zur Erhaltung des Dorfes Guarda. Chur: Kommissionsverlag Desertina, 2012.
- Ricarda Liver, Rätoromanisch. In: Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Ausgabe (Stand 2012)
- Stefan Bachmann, Heimatschutz. In: Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Ausgabe (Stand 2012)
- Filmbeitrag der Schweizer Filmwochenschau zum Chalandamarz 1965 in Samedan im BAR
- Selina Bisaz, Den Winter mit Lärm vertreiben. Chalandamarz und seine Tradition im Unterengadinin. In: Engadiner Post, 25. Februar 2017, S. 8.
- Nachruf Selina Chönz in der Engadiner Post vom 1. April 2000, S. 8.
- Magda Ganz, Chalandamarz – die Wintergeister vertreiben. In NZZ, 13. Februar 1997, S. 57.
Letzte Änderung 27.02.2025
Kontakt
Schweizerische Nationalbibliothek
SwissInfoDesk
Publikumsinformation
Hallwylstrasse 15
3003
Bern
Schweiz
Telefon
+41 58 462 89 35