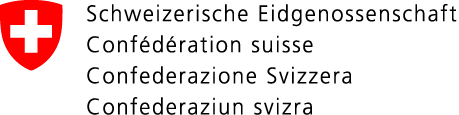Jedes Jahr im Mai füllen die meisten Stadtberner Freibäder ihre Bassins und eröffnen die Badesaison offiziell. Abertausende ziehen jedoch das Bad in der erfrischenden Aare im Marzili oder der Lorraine vor. Grund genug, einen Blick auf die Geschichte dieser Tradition zu werfen, welche grosses Vergnügen bereitet, jedoch auch Gefahren birgt.
Seit Jahrhunderten geniessen Menschen das Bad in Schweizer Flüssen, neben der Aare beispielweise auch im Rhein. In der Stadt Bern ist zumindest seit 1721 gesichert, dass die männliche Jugend in einem Seitenarm der Aare, der durch das heutige Freibad Marzili floss, einen Schwimmplatz fand. Dort war die Strömung weniger stark, als im offenen Fluss. Im oberen, seichteren Teil trug er nämlich den Namen Bubenseeli und im unteren, tieferen Abschnitt Studentenseeli. Leider gibt es aus dieser Zeit keine Quellen zu Schwimmerinnen. Dem Badevergnügen frönten trotz dieses Namens Leute allen Gesellschaftsschichten.
Aus der Literatur geht hervor, dass die Aare zwischen Elfenau und Engehalbinsel im ausgehenden 18. Jahrhundert an schönen Sommertagen einer einzigen grossen Flussbadeanstalt glich, wo sich Schwimmer und Schwimmerinnen (!) tummelten, leider auch an gefährlichen Badestellen. Und dass sich zum Ärger der sittentreuen Einwohnerschaft an den Abenden Personen beider Geschlechter unterhalb der Stadt Bern bei der Längmuur trafen. Anstoss erregte auch, dass sich viele Leute beim Umziehen an der Aare entblössten.
«Aarekultur» als Politikum
Damit sind gleich mehrere Gründe genannt, wieso die Berner Regierung in der gleichen Periode Massnahmen gegen den Sittenzerfall und für ein sichereres Badevergnügen ergriff. Sie erlaubte erst das Aareschwimmen noch bloss an drei Orten in der Stadt (Marzili, Dalmazi und Enge). Später verbot sie sogar ausdrücklich das Baden in der Matte und bei der Längmuur.
Nach und nach wuchs das Bedürfnis der Bevölkerung nach einem öffentlichen und freien Flussbad. Es gab zwar bereits warme Bäder und ab 1822 ein Freibad mit kühlen Bassin – allerdings gegen Eintritt.
Kurse für sichereres Aareschwimmen
Bei diesen Plänen eines neuen Bads stand immer der Standort Marzili im Vordergrund. Die Besitzer und Besitzerinnen der beiden Parzellen auf der kleinen Insel zwischen den beiden Flussarmen wehrten sich jedoch über Jahrzehnte gegen eine weitreichende Nutzung der Fläche als Badeplatz. Die Berner Regierung musste gegen diese den Rechtsweg beschreiten, um das althergebrachte Baderecht für die Bevölkerung zu erstreiten. Bis 1900 gelang es der Stadt schliesslich, die beiden Parzellen und ein Stück Land auf der Westseite des Aarelaufs zu erwerben.
Auf diesem Gebiet entstand nach und nach das Freibad Marzili in seiner heutigen Form. Bis 1968 bestand dort die Möglichkeit in der offenen Aare sowie auch im erwähnten Seitenarm zu schwimmen. Danach wurde der Kanal weitgehend zugeschüttet und die heutigen Bassins erstellt. Im Marzili und im 1892 geschaffenen Lorrainebad lernten die Mädchen und Jungen schwimmen und bereiteten sich so auf das weiterhin beliebte Baden in der offenen Aare vor. Aufgrund vieler tödlicher Unfälle in Flüssen und Seen gründeten Ersthelfende 1933 die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Diese engagiert sich seither stark für die Sicherheit in offenen Gewässern.
«Aarekultur» gestern und heute: Viele Parallelen
Der Vergleich der Vergangenheit mit der Gegenwart zeigt grosse Kontinuität: Die Menschen lieben den Aufenthalt an und das Schwimmen in der Aare seit Jahrhunderten, sie geniessen das erfrischende Bad genauso wie den Ausbruch aus dem Alltag in geselligem Zusammensein oder in der Nähe zur Natur.
Ebenso lange wie bereits in freien Gewässern wie der Aare geschwommen wird, begeben sich Schwimmerinnen und Schwimmer mit ihrem Vergnügen allerdings auch in eine gewisse Gefahr. Mit angemessenem Verhalten kann diese allerdings stark minimiert werden.
Das Aareschwimmen in Bern befindet sich auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz. Das Bundesamt für Kultur hat zum Aareschwimmen eine Dokumentation erstellt und zusammen mit Literaturhinweisen veröffentlicht. Die Website lebendige-traditionen.ch ermöglicht einen Überblick über das Thema.
Literatur und Quellen
- Aareschwimmen in Bern. In: Die lebendigen Traditionen der Schweiz. Website des Bundesamts für Kultur (BAK).
- Flussschwimmen – eine Spezialität Schweizer Städte. In: House of Switzerland. Website des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
- Hans Morgenthaler, Das Marzili-Inseli und die Anfänge der Flussbadanstalt Bubenseeli in Bern. In: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, 1932, Nr. 1, S. 199-220.
- Peter Gygax. Marzili : Berner Welt am Aareufer. Münsingen-Bern: Fischer, 1991.
- Stephan Lackner. Das SLRG-Buch = Le livre SSS = Il libro SSS. Nottwil: Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, 2008.
- Andreas Ruby, Shinohara Yuma. Swim City. Basel: Christoph Merian Verlag, 2019.
- Artikel in den Gemeinnützigen Nachrichten vom 14. Juli 1804 auf e-newspaperarchives.ch.
- Artikel in den Gemeinnützigen Nachrichten vom 22. August 1807 auf e-newspaperarchives.ch.
- Vereinsschriften der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) im Bestand der NB.
- Bulletins der Sektion Bern der SLRG von 1962 bis 2016.
- Bildnachweis: Walter Neeser: Bern, Marzilibad, 1931.06.30.
Letzte Änderung 16.05.2024
Kontakt
Schweizerische Nationalbibliothek
SwissInfoDesk
Nutzung
Hallwylstrasse 15
3003
Bern
Schweiz
Telefon
+41 58 462 89 35