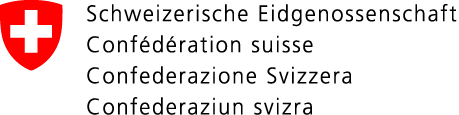In der wichtigsten Abstimmung der jüngeren Schweizer Geschichte sagen 50.3 Prozent der Stimmenden Nein zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die Schweiz ist gespalten – und entschliesst sich für den Alleingang.
Esther Mamarbachi, Journalistin und Politologin, zur EWR-Abstimmung
1992 bringt der Samichlaus neben Nüssen und Birnen auch eine knüppeldicke Überraschung: Mit dem Nein zum EWR folgt die Stimmbevölkerung einem Bündnis aus rechtsnationalen und linksökologischen Kräften. Der Bundesrat und die traditionellen Mitteparteien erleiden eine krachende Niederlage. Sie bildet den Auftakt zu einer Polarisierung und Personalisierung der Schweizer Politik.
Das Resultat ist denkbar knapp. Und es offenbart die Gräben, die das Land durchziehen. Mit fast 80 Prozent stimmt die französischsprachige Schweiz für einen Beitritt und steht damit im krassen Gegensatz zu den drei anderen Sprachregionen. Während die Wirtschaftsführer für die Liberalisierung der internationalen Märkte weibeln, wecken Outsourcing und Grossfusionen Ängste vor Arbeitslosigkeit und Überfremdung. Soll sich die Schweiz abgrenzen oder öffnen? 1992 spaltet diese Frage das Land.
Esther Mamarbachi zum EWR-Nein
NB: Frau Mamarbachi, wie verorten Sie das Nein zum EWR in der Schweizer Geschichte?
Esther Mamarbachi: In der Geschichte der Schweiz sollte man drei Daten nicht vergessen: 1291 den Beginn der Gründung der Schweiz, 1848 die Errichtung der modernen Schweiz als Bundesstaat und schliesslich 1992, als die Schweiz ihre Unabhängigkeit und Andersartigkeit beschliesst.
Was ist Ihnen von der EWR-Abstimmung in Erinnerung geblieben?
Zunächst bleiben mir Bilder. Und dann die Rede von Delamuraz: „Ein schwarzer Sonntag“. Diese Abstimmung war ein identitätsstiftendes Ereignis.
Das Nein zur EWR wurde von der SVP und Teilen der Grünen propagiert. Haben diese die Schweizer Politik verändert?
Ehrlich gesagt wusste ich nicht mehr, dass die Grünen gegen den EWR waren. Ich erinnere mich aber gut an die SVP und Christoph Blocher, die damals die Nein-Kampagne prägten. Aber natürlich übernehmen auch die Grünen immer wieder eine konservative Rolle. Christoph Blochers Weg habe ich als Politikwissenschaftlerin verfolgt und ihn damals auch für ein Buch interviewt, für das wir vom Journal de Genève einige Jahre nach der EWR-Abstimmung verschiedene wichtige Personen befragten. Die zwei prägenden Figuren der Zeit waren einerseits Jean-Pascal Delamuraz, der offensichtlich der Motor der Annäherung an Europa war, und andererseits Christoph Blocher. Zu diesem Zeitpunkt fing sich die Schweizer Politik auch vermehrt an zu personalisieren. In unserem Land zählte die politische Persönlichkeit damals noch weniger als in anderen Ländern, wo die politische Landschaft polarisierter war. Dabei traten auch Figuren wie Christoph Blocher und Jean-Pascal Delamuraz zu Tage.
Die EWR-Abstimmung steht auch für den „Röstigraben“.
Der „Röstigraben“ zeigt sich in der EWR-Abstimmung sehr deutlich. Vor 1992 hat man weniger darüber gesprochen, auch wenn der Begriff in den späten 1970er-Jahren in der Presse aufkam. Aber erst ab 1992 wurde er viel verwendet, wohl zum Teil auch missbräuchlich. Offensichtlich gab es einen augenfälligen Unterschied zwischen deutsch- und französischsprachiger Schweiz bei dieser Abstimmung. Für mich war der Begriff zu diesem Zeitpunkt zutreffend. Seither hat der „Röstigraben“ aber an Erklärungskraft eingebüsst. Er erlaubt uns heute nicht mehr, Abstimmungsergebnisse zu „lesen“. Heute gibt es andere Gegensätze, die die politische Landkarte bestimmen, insbesondere den Gegensatz zwischen Stadt und Land.
Hat sich der Blick auf die europäische Zusammenarbeit nach 1992 verändert?
Für gewisse Politiker ist es nicht einfach, mit diesem Moment umzugehen, weil sie heute wissen, dass sie damals nicht unbedingt Recht hatten. Ökonomisch gab es zwar einige Jahre der Stagnation, aber der prophezeite Zusammenbruch fand nicht statt. Politisch wiederum hat sich eine gewisse Kreativität gezeigt, neue Kommunikationswege mit den europäischen Partner herzustellen. Ich denke, wir waren auch eine Art Vorreiter. Heute zeigt sich das grosse europäische Ensemble in der Krise und vielleicht erweist sich die Art, die wir für die Kommunikation mit Brüssel entworfen haben, als Modell für andere Staaten und Regionen. Die Bilanz, die ich zu dieser Abstimmung ziehe, ist also eher positiv.