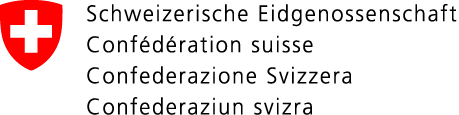In diesem Frühjahr hat der Schriftsteller Hansjörg Schertenleib seinen ersten Mundartroman veröffentlicht. Ein Blick in sein Archiv zeigt, dass er schon viel früher in seinem Dialekt geschrieben hat.
Von Lucas Marco Gisi
Um Verlust, aber auch um Liebe geht es in dem Monolog, den Thomas an seine eben verstorbene Ehefrau richtet. Mit allen rhetorischen Mitteln seines Dialekts – vom Fluch bis zum Galgenhumor – redet er in Hansjörg Schertenleibs «S’Wätter vo Geschter» gegen den Tod an. Von Gabys Leben zeugen auch die vielen Listen, mit denen sie die Herausforderungen des Alltags und die Krebserkrankung zu bewältigen versuchte. Die Aargauerin, die unter Alkoholeinfluss Berndeutsch zu reden begann, notierte «altmodischi züritüütschi Wörter» wie «Galööri», «Mägerlimuck» oder «Lamaaschi», um sie ihrem Sohn beizubringen. Die von ihm so geliebten Mundartausdrücke endlich in einem Buch unterzubringen, war auch für Schertenleib, der selbst einen aargauerisch abgeschliffenen Zürcher Dialekt spricht, einer der Hauptgründe, um nach 43 Jahren als freier Schriftsteller erstmals einen Mundartroman zu schreiben.
Spiel mit Gehörtem

Aber es handelt sich keineswegs um Schertenleibs ersten Mundarttext. In seinem Archiv, das er 2022 ans Schweizerische Literaturarchiv übergeben hat, finden sich etwa mehrere Mundarthörspiele. «Lektionen» (2008) veranschaulicht, wie sich durch das Verbot sprachlicher Varietäten die freie Meinungsäußerung einschränken lässt. Zu Beginn versucht ein junger Mann, seiner Freundin seinen Dialekt aufzuzwingen, während sie ihr «Chuderwälsch» verteidigt. Später wird er selbst von einem alten Mann gezwungen, Hochdeutsch zu sprechen.
Mehr durch Zufall kommt der Lebenskünstler Max, aus dem später Fax wird, in einem «Radio-Comic» (1989) den kleinkriminellen Machenschaften der «Hebise-Brüeder» auf die Spur. Natürlich geht es nur vordergründig um den Fall und vielmehr um das Erzählen der urkomischen Szenen selbst, in die die Figuren geraten. Die Erzählstimme wird immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen («Verzell endli wiiter!!!») und wendet sich am Schluss jeder Episode an die Hörerinnen und Hörer, die über die Fortsetzung der täglich gesendeten Folgen abstimmen müssen. Fast zehn Jahre später darf das DRS3-Publikum dem gealterten «Fax» (1998) bei einem Entführungsfall helfen. Aus dem Krimi ist längst eine Satire auf das Tagesgeschehen, eine Persiflage der Populärkultur und letztlich eine Parodie des Mediums Radio selbst geworden. Schertenleibs Hörspielkomik wirkt zugleich wie direkt aus dem Leben gegriffen und wie dessen distanzierte ironische Betrachtung.
Ausdruckskraft der Mundart
Um ein grösseres Publikum zu erreichen, hat Schertenleib von Anfang an in der Standardsprache geschrieben. Trotzdem sei das Hochdeutsche für ihn eine «Fremdsprache» geblieben. Endlich einen längeren Mundarttext zu schreiben, war somit einerseits eine neue Herausforderung, andererseits das Ergebnis der lebenslangen Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache. Mit seinen Mundarttexten will er nicht eine Kunstsprache entwickeln, sondern den Menschen das wirklich Gesprochene «abhören». Die Mundart eignet sich daher besonders für dialogische Textformen. Aber es geht nicht primär um eine realistische Darstellung, sondern darum, die Ausdruckskraft der gesprochenen Sprache literarisch zu nutzen. Während die Mundart in den frühen Hörspielen dazu dient, Alltagsdiskurse parodistisch zu überschreiben, gelingt es Schertenleib in dem späten Roman eindrucksvoll, damit auch für ernste Themen den richtigen Ton zu finden.
Hansjörg Schertenleib, geboren 1957 in Zürich, gelernter Schriftsetzer und Typograph, ist seit 1982 freier Schriftsteller. Seine Novellen, Erzählbände und Romane wie die Bestseller «Das Zimmer der Signora» und «Das Regenorchester» wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, seine Theaterstücke auf der ganzen Welt auf die Bühne gebracht. Schertenleib lebte zwanzig Jahre in Irland, vier Jahre auf Spruce Head Island in Maine und wohnt seit Sommer 2020 im Burgund.
Letzte Änderung 01.07.2025