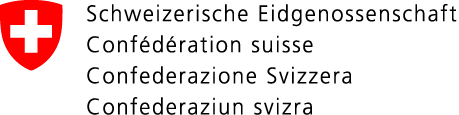Die Schriftstellerin Erica Pedretti wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat Mähren vertrieben. Von den politischen Umbrüchen jener Zeit erzählen in ihrem Archiv nicht nur ihre eigenen Ausweispapiere.
Von Sophie Mikosch
Hannah Arendt bezeichnete sie als «soziale Mordinstrumente», bei Bertolt Brecht werden sie ironisch der «edelste Teil eines Menschen» genannt: Pässe und Ausweise. Es sind ambivalente Dokumente – manche Menschen privilegieren sie, manche Menschen stigmatisieren sie. Den einen ermöglichen sie Freiheit und Mobilität, für andere, die vor Verfolgung und Krieg fliehen und zwischen die Grenzen von Nationalstaaten geraten, bedeuten sie oft Diskriminierung und Entrechtung.

So nüchtern wie eindringlich erzählen knapp 50 Ausweispapiere im Nachlass der Schriftstellerin und bildenden Künstlerin Erica Pedretti (1930–2022) von Flucht und Vertreibung. Einige dieser Personaldokumente sind auf Pedretti selbst ausgestellt, der überwiegende Teil davon stammt jedoch von ihren Eltern, Grosseltern, Tanten und Onkeln. Darunter befinden sich Flüchtlingsausweise, Grenzkarten, Transitvisa, Alliierten-Reiseerlaubnisse, Kennkarten und Durchlassscheine – ausgestellt zwischen den 1920er- und 1990er-Jahren von Behörden in der Tschechoslowakei, dem Deutschen Reich, der DDR, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz.
Geboren wird Erica Pedretti 1930 als Erika Schefter im mährischen Sternberg in der ehemaligen Tschechoslowakei. Die Jahre ihrer Kindheit und frühen Jugend verbringt sie überwiegend in Nordmähren; dort erlebt sie auch die Kriegsjahre. Kurz nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht wird die deutschsprachige Bevölkerung, zu der auch Pedrettis Familie gehört, aus den tschechoslowakischen Gebieten vertrieben und zwangsausgesiedelt. Ihr Vater und ihr Onkel kommen in deutsche, später in tschechische Lagerhaft. Zusammen mit ihren Geschwistern kann Pedretti im Dezember 1945 in einem Rotkreuztransport in die Schweiz zu Verwandten ausreisen – allerdings unter der ständigen Aufsicht der Fremdenpolizei und mit einer nur vorübergehenden Aufenthaltsbewilligung. 1950 migriert die Familie weiter in die USA.
Sowohl ihr literarisches als auch ihr künstlerisches Werk sind eng an diese Kindheitserfahrungen geknüpft: die Kriegsschrecken, die Vertreibung, der Verlust von Heimat und das unüberwindbare Fremdbleiben. In ihren Erinnerungstexten versucht Pedretti in literarisch hoch stilisierter Form, sich dieser Vergangenheit zu nähern. Dabei vermischt sich die Vergangenheit in Mähren immer wieder mit der Gegenwart in der Schweiz, in der sie seit 1952 lebt, und das Erinnern wird zum Gegenstand des Erzählens selbst. So heisst es in ihrem ersten Werk «Harmloses, bitte» (1970) etwa: «Erinnertes, Gelesenes, Erzähltes, Geträumtes: übereinander projiziert, Bilder, die sich überschneiden, überdecken, nicht mehr auseinanderzulösen».
Es sind aber nicht nur die Erinnerungen Pedrettis, sondern auch die ihrer Familienmitglieder, die sie literarisch verarbeitet. Der Roman «Engste Heimat» (1995) erzählt in der literarischen Figur des Onkels Gregor die Lebensgeschichte des Malers Kurt Gröger, des Onkels von Pedretti, der während des Zweiten Weltkriegs gegen Nazideutschland kämpft und nach dem Krieg nach Paris flüchtet. Die Rückkehr in seine Heimat wird ihm später verwehrt, weil er «für die Tschechen […], obwohl er grade erst als Tschechoslowake gegen Deutsche sein Leben riskiert hatte, ein Deutscher» war.
Die Pässe und Ausweise im Archiv Pedrettis sind weit mehr als formale und behördliche Dokumente; es ist persönliches wie kollektives Erinnerungsmaterial. Sie erinnern an die gewaltsame Neuordnung Europas im 20. Jahrhundert und stehen stellvertretend für das Schicksal unzähliger Familien aus Mähren, Böhmen und Schlesien, die während und nach dem Krieg entwurzelt, auseinandergerissen und über Ländergrenzen hinweg zerstreut wurden.
Nicht nur das Werk Pedrettis, sondern auch ihr Archiv wird so zu einem Ort des Erinnerns – und wider das Vergessen.
Erica Pedretti (1930–2022) veröffentlichte vierzehn grössere und kleinere Prosawerke, daneben auch Hörspiele, Essays und Schriftbilder, die sie selbst «Überschreibungen» nannte und in denen sie ihre schriftstellerische und künstlerische Tätigkeit miteinander verband. Neben ihren Erfolgen als Schriftstellerin – darunter 1984 der Ingeborg Bachmann-Preis – entstand zugleich ein umfangreiches künstlerisches Œuvre.
Letzte Änderung 01.07.2025