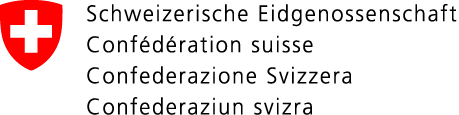Die Nationalsozialisten entzogen dem Grafiker Alexander M. Kaiser alias A. M. Cay 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft und sein Vermögen. Über viele Stationen in Frankreich floh er 1943 in die Schweiz und beteiligte sich an Geheimoperationen: Er zeichnete Flugblätter für die Alliierten, die die deutsche Bevölkerung von der Sinnlosigkeit des Krieges überzeugen sollen.
Von Karl Clemens Kübler
Das Grafikatelier A. M. Cay in Berlin-Schöneberg ist am Ende der 1920er-Jahre ein gefragtes Büro für die Gestaltung von Plakaten und Werbemitteln. Als Alexander M. Kaiser, der Mann hinter dem bekannten Pseudonym und umtriebiger Geschäftsmann, im Jahr 1929 eines der grössten Theater Berlins umbaut, befindet er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Kaiser alias «Cay» lehrt als Gestalter und berät öffentliche Institutionen. Auch arbeitet er für Auftraggeber in Frankreich und den USA. Doch alles ändert sich 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland.
Nur wenige Jahre später zieht Kaiser als geflüchteter Staatenloser ohne nennenswertes Vermögen zunächst durch Frankreich, dann durch die Schweiz, von Arbeitslager zu Arbeitslager, und zeichnet den Krieg, dem er entkommen ist: Totenköpfe, Leichen und ausgebombte Städte.
Die Graphische Sammlung der Nationalbibliothek verwahrt einen bedeutenden Teil der erhaltenen Zeichnungen Kaisers, die eine ganz eigene Geschichte von der Flucht des einst Etablierten und seinem Exil in der Schweiz erzählen – und vom künstlerischen Engagement gegen den deutschen Faschismus.
Von Berlin über Paris in die Schweiz

Bald nach seiner Ankunft in der Schweiz 1943 begann Kaiser im Geheimen Zeichnungen anzufertigen, die der amerikanische Geheimdienst «Office of Strategic Services (OSS)» als Flugblätter im Kampf gegen Hitler vervielfältigte und von Bern aus im Deutschen Reich verbreitete. Dies war ein Drahtseilakt in der politisch neutralen Schweiz, wo die Anfertigung von Propagandamaterial aller Art verboten war. Das OSS in Bern tarnte sich dabei als eine Kommunikationsabteilung der amerikanischen Botschaft, doch unterhielt es ein weit verzweigtes Netzwerk über die gesamte Schweiz hinweg bis nach Deutschland und Italien. Beispielhaft wird auf einer Zeichnung der Unwille zweier Frontsoldaten im Gespräch, das im Berliner Dialekt geführt wird, deutlich, weiter für eine verlorene Sache zu kämpfen.

Insbesondere nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 1944 hatten die Berner Agenten die Anweisung, weiteren Unmut in der deutschen Bevölkerung zu schüren. Kaisers Flugblätter sollten die breite Bevölkerung und die deutschen Soldaten davon überzeugen, dass eine Verlängerung des Krieges nur mehr Opfer brächte. Dafür sprachen sie die Ungerechtigkeit des NS-Systems, seine Verbrechen und die persönliche Bereicherung der Führungselite in Bild und Text direkt an.
Das Problem des flüchtigen Mediums

Heute sind nur mehr 66 solcher Flugblattzeichnungen erhalten, die eindeutig Kaiser zugeschrieben werden können. Sie mögen in ihrer Deutlichkeit abschrecken, machen damit aber ihren Gebrauchscharakter kenntlich: Sie sollten die Gräuel des Krieges in krassen Motiven zeigen, um dessen Sinnlosigkeit hervorzuheben. Zerstörte Städte, Gefolterte und Ermordete sowie Karikaturen bekannter Funktionsträger bilden Kaisers hauptsächliches Repertoire. Er bedient sich ihrer nicht zuletzt auch, um Wut und mögliche Gewaltphantasien an Hitler und dem Machtapparat anzuregen. Doch sollten die Bilder die deutschen Betrachtenden in erster Linie davon überzeugen, dass eine Kapitulation gegenüber den anrückenden Alliierten besser wäre, als noch für Hitler zu sterben.

Wenngleich das OSS genaue Vorstellungen hatte, welche Botschaften mittels des Mediums Flugblatt ins Deutsche Reich übermittelt werden sollten, lassen die Zeichnungen aber auch eine besondere Formsprache Kaisers erkennen. Sie offenbaren seine zeichnerische Vielseitigkeit und seinen Ideenreichtum selbst in einer scheinbar simplen Gattung wie der Propagandazeichnung. Indem Kaiser den grossen Führer als schematisches Strichmännchen mit dem Detailreichtum der Skelette seiner Opfer kontrastiert, deutet er schon die kommende Befreiung voraus: Die Witzfigur des Diktators wird bald verschwinden, und die Nachwelt wird über seine Taten richten.
Späte Ankunft in Zürich
Welche Reichweite die Flugblätter hatten und wie sie auf die deutsche Bevölkerung wirkten, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Alexander M. Kaiser konnte sich nach Ende des Krieges in Zürich wieder unter seinem Pseudonym A. M. Cay als Karikaturist und Werbezeichner etablieren. Für die Zeitschriften Sie & Er und vor allem für den Nebelspalter karikierte er noch bis in die 1960er-Jahre die Mächtigen dieser Welt.
Alexander M. Kaiser alias A. M. Cay wurde am 20.09.1887 in Wien geboren. Eigenen Angaben zufolge soll er tschechischer, später deutscher Nationalität gewesen sein, bevor er in den 1930er Jahren staatenlos wurde. Nach einer Ausbildung zum Kunstmaler in Wien und Tätigkeit an Theatern in London war Kaiser noch vor dem ersten Weltkrieg nach Berlin übersiedelt. Dort war er als selbstständiger Werbegrafiker und Architekt in eigenem Atelier unter dem Pseudonym A. M. Cay tätig. Im Jahr 1929 wird Kaiser mit dem Umbau des Plaza Theaters in Berlin betraut. 1938 flieht Kaiser vor den Nationalsozialisten nach Frankreich und wird mit Kriegsbeginn in verschiedenen Lagern interniert, bis er Anfang 1943 in die Schweiz flieht. Nach Hilfstätigkeit als Zeichenlehrer fertigte Kaiser ab 1946 regelmässig Karikaturen für «Sie und Er», den «Nebelspalter» und andere Publikationen an. Alexander M. Kaiser verstarb 1971 in Zürich.
Literatur und Quellen
- Klaus Kirchner; Michel Girard (Hrsg.): Flugblätter aus Frankreich 1939, 1940. Erlangen: Verlag D + C, 1981.
- Klaus Kirchner: Erotische Flugblätter in Europa im 20. Jahrhundert. Erlangen: Verlag D + C, 2010.
- Christof Mauch: Schattenkrieg gegen Hitler: das Dritte Reich im Visier der amerikanischen Geheimdienste 1941 – 1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1999.
- Moritz Rauchhaus, Tobias Roth (Hrsg.): Eine Sammlung amerikanischer, britischer, deutscher, französischer und sowjetischer Feindflugblätter des Zweiten Weltkriegs. Berlin: Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, 2020.
Letzte Änderung 07.04.2025
Kontakt
Schweizerische Nationalbibliothek
Graphische Sammlung
Hallwylstrasse 15
3003
Bern
Schweiz
Telefon
+41 58 462 89 71