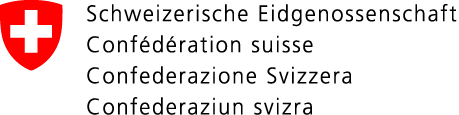Grotti sind ursprünglich Felsenkeller zur Lebensmittellagerung: Die Luftzirkulation in den Felsformationen wird geschickt genutzt, um ein stabiles Raumklima zu schaffen. Einige Grotti wurden ausgebaut, mit einer Terrasse ergänzt und im Sommer als Gaststätte genutzt. Nach wie vor sind die Grotti für eine unkomplizierte Einkehr sehr beliebt.
Das Grotto: Wein, Käse, Wurst, Polenta und Mandolinenklänge, eine fröhliche Gästeschar an Steintischen unter Kastanienbäumen, irgendwo im Kanton Tessin oder auch in den Bündner Südtälern. Ungefähr so präsentiert sich das – stereotype – Bild der Gastwirtschaft, die sich Grotto (in der Mehrzahl Grotti) nennt. Wie hat es das Grotto auf die Liste der lebendigen Traditionen geschafft?
Immer ein angenehm kühles Lüftchen
Schon seit langer Zeit werden im Tessin und in den südlichen Regionen Graubündens natürliche Felsenkeller zur Vorratshaltung genutzt. Für die Lagerung von Wein, aber auch für Vorräte wie Käse, Wurstwaren und Gemüse benötigte man genügend Platz und ein kühles, stabiles Klima.
Die idealen Bedingungen in den Felsenkellern entstehen durch die Temperaturunterschiede zwischen den Luftmassen im Bereich der porösen Felswände und dem Aussenbereich des Grottos: Die natürlichen Hohlräume und Spalten in den Felsen, die als Rückwand dienen, und die beim Bau der Grotti ausgesparten Luftschlitze in den Aussenmauern, sorgen im Vorratsraum für einen kontinuierlichen Austausch von warmen und kühlen Luftmassen. Im Grotto herrschen ganzjährig stabile Temperaturen von um die 10 bis 12 Grad – ideal für die Vorratshaltung.
Die Grotti liegen in der Regel etwas ausserhalb der Dörfer, meist in der Nähe schattenspendender Bäume, die an heissen Sommertagen zusätzlich zur Kühlung beitragen. Nach und nach wurden die Felsenkeller vergrössert und um angebaute Räume bis hin zu einfachen Häuschen erweitert.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Grotti zu einem beliebten Treffpunkt, wo sich Dorfgemeinschaft im Sommer zum Essen und Trinken versammelte. Mit der Zeit folgte die Öffnung für Gäste mit Ausschank von Wein und anderen Getränken und einem Angebot an einfachen Speisen. In «Il San Bernardino» vom 2. Juni 1928 findet sich der Artikel «I nostri Grotti!!» der die Frühlingsgefühle mit froher Einkehr im Grotto beschreibt. Waren die Grotti anfangs bloss an Anlässen wie Feiertagen zugänglich, wurden die Öffnungszeiten kontinuierlich erweitert. Eigentliche Gastbetriebe entstanden.
Südländische Lebensfreude und Leichtigkeit
Mit dem aufkommenden Tourismus wurden die Grotti auch nördlich der Alpen ein Begriff. «Die Neuen Zürcher Nachrichten» berichten am 15. Oktober 1937 über die «südlich heitere Stimmung» im Grotto, das für kurze Zeit in einem Zürcher Warenhaus eingerichtet wurde. Auch an der Landesausstellung 1939 wurde ein Grotto Ticinese aufgebaut, wie die «Neue Zürcher Zeitung» am 23. Oktober 1939 in einem Artikel über die Tessiner Schlussfeier schreibt: Gerne hätte man das Grotto noch länger in Betrieb gesehen. Zwei Jahrzehnte später war das Grotto Ticinese erneut Treffpunkt – diesmal an der Berner Ausstellung BEA, worüber das «Journal du Jura» am 16. Mai 1960 berichtete.Die positive Ausstrahlung des Grottos nutzte auch der Tessiner Bundespräsident Flavio Cotti, der den «Brückenbauer» im Dezember 1997 zum Interview in ein Grotto einlud.
Leichtigkeit, Geselligkeit, schmackhaftes Essen wie in der «Sonnenstube Tessin»: Auch nördlich der Alpen entstanden Restaurants, die sich Grotti nannten und sich an den Traditionen der Südschweiz orientierten. Was damals noch exotisch anmutete, ist heute auch nördlich der Alpen ein fester Bestandteil der Schweizer Gastronomie. In der italienischsprachigen Schweiz lebt die Kultur der Grotti weiter: Lokale, die insbesondere im Sommer traditionelle Gerichte aus regionalen Produkten anbieten.
Kühltruhe statt Grotto – Baukulturerbe bewahren
Das natürliche Kühlsystem der Grotti musste der Technik Platz machen: Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt der Kühlschrank Einzug in die Haushalte. Viele Grotti wurden nicht mehr zur Vorratshaltung genutzt, einige Bauten verfielen. Doch die Bautradition soll bewahrt werden. Das gelingt durch Initiativen wie dem Sentiero dei Grotti in Cevio (Maggiatal), dem Rundgang durch die Grotti von Cama im Misox oder die Cantine di Mendrisio.

Das Grotto: Bewährte Bauweisen und regionale Gastronomie, Vorratshaltung und Geselligkeit – Aspekte einer lebendigen Tradition, die in der Schweizer Nationalbibliothek dokumentiert ist.
Literatur und Quellen
- Francesca Luisoni. Kultur der Grotti in der italienischen Schweiz. In: Die lebendigen Traditionen der Schweiz. Webseite des Bundesamts für Kultur (BAK)
- Maria Caronesi. I nostri Grotti!!. In: Il San Bernardino, 2. Juni 1928, S. 2.
- Tessinerfreuden im Globus. In: Neue Zürcher Nachrichten, 15. Oktober 1937, S. 3.
- Schweizerische Landesausstellung in Zürich, Schlussfeier im Grotto. In: Neue Zürcher Zeitung, 23. Oktober 1939, Ausgabe 3, S. 6.
- La BEA 1960 a ouvert ses portes à Berne. In: Journal du Jura, 16. Mai 1960, S. 4.
- Rolf C. Ribi: Wenn der Tessiner Bundespräsident Flavio Cotti in einem Grotto in seiner Heimat des Locarnese ein rustikales Mahl auftischen lässt und einen Jass klopft. In: Wir Brückenbauer, 17. Dezember 1997, S. 29.
- Flavio Zappa: Grotti e cantine a Moghegno. In: Kunst und Architektur in der Schweiz 61(2010), S. 12-20.
- Andrea a Marca; Ivan Magistrini. Grotti, cantine, canvetti. Bellinzona: Centro di dialettologia e di etnografia, 2014.
- Albert Adler. Kleines Landi-Potpourri: Ein heiteres Erinnerungswerk von der Schweiz. Landes-Ausstellung 1939. Neuallschwil-Basel: Verlag Bolliger & Co., [1940].
- Luca Bettosi; Marina Susinno. Scarpinando per grotti e paesi: trenta grotti, un agriturismo e una capanna con proposta d’escursione in Ticino. Lugano: Associazione vivere la montagna, 2003.
- Edy DeBernardis. Il boccalino: storia e storie del re dei grotti. Pregassona: Fontana, 2005.
- Dante Peduzzi. Andiamo ai grotti: testimonianze di un intervento sul territorio del Comune di Cama Grigioni 2004-2009. Cama: Fondazione per la rivitalizzazione dei grotti di Cama, 2009.
Letzte Änderung 19.08.2025
Kontakt
Schweizerische Nationalbibliothek
SwissInfoDesk
Nutzung
Hallwylstrasse 15
3003
Bern
Schweiz
Telefon
+41 58 462 89 35