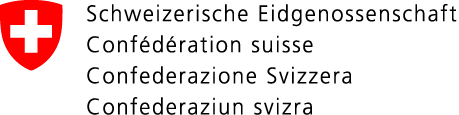Die Selbstvermarktung ist ihm fremd, er bleibt ganz bei der Sprache: Der Schriftsteller Felix Philipp Ingold wurde am 25. Juli 80 Jahre alt.
Von Magnus Wieland
Am 29. Juni 1969 erschien in der NZZ der Essay «Was ist Poesie?» des russischen Formalisten Roman Jacobson, übersetzt – und zwar «erstmals in einer westlichen Sprache» – von Felix Philipp Ingold. Der gerade als Lyriker debütierende Promovend in Slawistik – 1967 erschien mit «Schwarz auf Schnee» sein erster Gedichtband, zwei Jahre später die Dissertation – legte mit dieser Übersetzung nicht nur den Grundstein für die deutschsprachige Rezeption Jacobsons, sondern zugleich auch für das ästhetische Paradigma, in dem er selber als Autor hervortreten sollte. So findet sich in dem 1980 publizierten Prosaband «Leben Lamberts» eine sprachspielerische Hommage an den Vordenker: «Romane für Jakobson». Mit dem herkömmlichen Romangenre hat diese Kurzprosa allerdings nichts zu tun, vielmehr veranschaulicht sie ein zentrales Theorem Jacobsons: die Poetizität, die er im besagten Essay wie folgt erläutert: «daß das Wort als Wort, und nicht als bloßer Repräsentant des benannten Objekts oder als Gefühlsausbruch, empfunden wird.»

Das Beispiel zeigt, wie eng Ingolds Tätigkeit als Schriftsteller, Übersetzer und Literaturtheoretiker ineinander verflochten ist. Für den «poeta doctus», der von 1971 bis 2005 an der HSG lehrte, blieb das Prinzip der sprachlichen Eigendynamik bis heute massgebend. Weder in seiner Lyrik noch in der Prosa geht es darum, etwas oder gar sich auszudrücken, sondern um die Modulierbarkeit des sprachlichen Ausdrucks selbst. In dem Grad jedoch, wie die textuelle Selbstreferenzialität zunimmt, schwindet die Position des Autors. Wenn Ingold, einer der versiertesten Literaten der Gegenwart, trotz namhafter Preise – u.a. Petrarca-Preis (1989), Literaturpreis des Kt. Bern (1998), Ernst Jandl Preis (2003), Basler Lyrikpreis (2009) – in der Öffentlichkeit wenig präsent ist, so liegt das an einem von ihm auch mehrfach theoretisierten Autorschaftskonzept, das sich konträr zur gängigen Selbstvermarktung verhält: Während heute das Image des Autors oft vor seinen Büchern steht, so ging Ingolds Autorschaft stets schon vollständig in der Schrift auf und in seine Texte ein. Der Autor wird dadurch schwer fassbar, wird zum Phantom, wie die Figur Ingold in der Erzählung «Ewiges Leben» oder wie auf dem ungewöhnlichen ‘Selbstporträt’, das sich im Archiv des Autors findet. Es handelt sich um einen Zeitungsschnipsel, der das Radarbild eines Schiffes zeigt. Die Bildunterschrift modifiziert Ingold nur geringfügig auf sich selbst: «Felix Philipp Ingold. Kein Photo; dennoch mit Beweiskraft. Radarinformationen fügen sich zum Bild. Der helle Fleck – Quelle der Verschmutzung, die sich als dunkle schattenhafte Fläche abhebet – ist der Autor.»
Eine paradoxale Pointe, wie sie charakteristisch ist für Ingolds Denkweise: Der Autor zeigt sich nicht, er muss geortet werden – und doch ist auf dem Radar nichts zu sehen. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert eine ebenfalls im Archiv befindliche Gelegenheitsmontage, die vage an Malewitschs «Schwarzes Quadrat» erinnert: An die Werbeseite aus einem Kunstmagazin mit der kleingedruckten Zen-Weisheit «Round / as the great void: Nothing to add, nothing to take away» wird ein Ausriss mit der Letternfolge ICH appliziert. Wie die Position des Autors so ist auch dieses Ich nicht subjektiv gesättigt, sondern markiert buchstäblich eine – zwar nicht identifizierbare, aber durchaus lesbare – Leerstelle.
Felix Philipp Ingold (*1942) ist habilitierter Literaturwissenschaftler, Übersetzer aus dem Russischen und Französischen, Feuilletonist und Autor zahlreicher Gedichtbände, Prosawerke, kulturhistorischer Essays und experimentellen Arbeiten. Anfang Jahr erschien der aktuelle Roman «Die Zeitinsel», auf Herbst angekündigt ist das Sachbuch «Denken im Abseits».
Letzte Änderung 04.08.2022