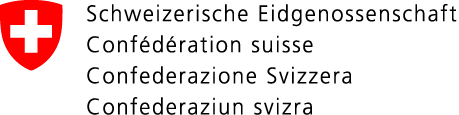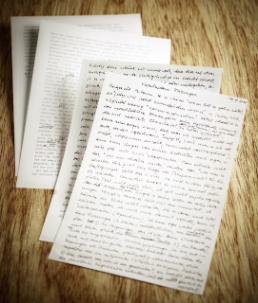
Liebesaffäre
«[...] und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen», schrieb Wittgenstein, auf den sich Jürgen Theobaldy im folgenden Text unter anderem bezieht. Er, der Dichter, findet Worte, mit denen er uns Leserinnen und Leser gleichsam seinen Gedichte-Raum zeigt. Dort gehen die Wörter «in einen anderen Zustand» über und können «alles besagen, insofern sie keinen eindeutigen, gar wörtlichen Bezug auf das Draussen haben müssen». Wann aber sind sie reif für die Veröffentlichung? Verdienten nicht manche es, zurückkehren zu dürfen um weiter bearbeitet zu werden?
Statt schweigen, wie oben zitiert, hebt Jürgen Theobaldy mehrmals an um zu reden: Er behält sich das Recht vor, zurückzuholen, auch wenn Erzeugnisse - ob Lyrik oder Prosa - aus seinem Schreiblabor bereits bei der Leserschaft angekommen sind. Weiterschreiben. Ziel ist nicht Vollkommenheit, Ziel ist das Bewahren der «Liebesaffäre mit der Sprache».
Weiterschreiben
Wenn man sagen kann, dass man ein Gedicht, an dem man arbeitet, letztlich nicht vollendet, sondern aufgibt, dann kann Borges von seinen Gedichten auch sagen, er habe sich mit ihnen «abgefunden». Denn man schreibe nicht das, «was man schreiben möchte», sondern das, «was man zu schreiben fähig ist». Für die Großspurigen unter den Autoren mag das in eins fallen, zumindest subjektiv, Borges' «Credo» jedenfalls, 1967/68 in Harvard vorgetragen, hilft mir aus dem quälenden Verdacht, ich könnte die Bücher nicht schreiben, die zu lesen mich einzig interessierten. Wenn ich mich nun abfinde mit dem, was ich aufgegeben habe, nachdem die von mir angestossene Bewegung der Sprache im Gedicht, meine Liebesaffäre mit der Sprache, das Abenteuer des Schreibens am Ziel schien, kann ich weiterschreiben. Auch kann ich, in Grenzen, verschiedene Fassungen von Gedichten veröffentlichen, ohne mich des Wankelmuts bezichtigen zu müssen.
Ich lese eigene Gedichte wieder, im Manuskript, auf dem Bildschirm, irgendwann in Zeitschriften gedruckte, und sehe, dass ich einige vor Jahren doch zu früh verlassen, doch vorzeitig weggegebenen habe, womöglich schon damals ahnend, das letzte Wort sei noch nicht geschrieben. Längst nicht mit jedem Gedicht widerfährt mir das, viele Gedichte muss ich im Wissen aufgeben, dass ihr Weg in die Vergessenheit ohnehin unabweislich ist. Aber das eine und andere Gedicht möchte ich doch noch bei mir halten, um daran weiter zu arbeiten - aus Lust an der Improvisation, ähnlich wie im Jazz und im Rock, gleichsam Neueinspielungen, in denen Nebenbedeutungen, Zwischen- und Untertöne nach vorne drängen, die ich einst nicht wahrgenommen oder für nebensächlich erachtet habe. Dann können die Fassungen sogar als verschieden reizvolle, gar gleichwertige Varianten nebeneinander stehen.
Dieses entspannte, nicht respektlose Verhältnis zum eigenen Werk umfasst die Absage an jene Kunstreligion, für die Vollkommenheit und Kunstwerk zwei Wörter für ein und dasselbe waren. Nun geht es um das Machen, um den Prozess des Schreibens selber, um das Gedicht als etwas unendlich Offenem, das jeder Leser, jede Leserin, ohne die es keine Gedichte gibt und vor denen Gedichte zu Recht immer hier und jetzt sind, für sich erkunden und auf ihre je eigene Weise erschließen. Das ist möglich, weil sich das Unsagbare, so nicht nur Wittgenstein, im Gesagten bloss «zeigen» kann, anders herum: weil der Pfeil nicht direkt auf das Ziel gerichtet wird, um zu treffen.
Mit dem ersten Wort, das ich so setze, tritt mein Vers ein in den Gedichte-Raum, wo die Wörter, auch die üblichsten, von den Festlegungen der gewöhnlichen wie der wissenschaftlichen oder sonst funktionalen Sprache befreit sind. Die Wörter gelangen in den anderen Zustand, schlicht den poetischen, und dort können sie alles besagen, insofern sie keinen eindeutigen, gar wörtlichen Bezug auf Draussen haben müssen und darum übrigens auch keine einforderbare politische Aufgabe. Einmal in diesen Raum der lyrischen Stimmen eingedrungen, kann das Gedicht lauten, wie es will, gar roh und unartifiziell daherkommen wie in den 1970er Jahren, als es den jungen Dichtern darum ging, die Lyrik zu erfrischen und auf erregende Weise die Freiheit des Sagens mit der Bindung an die Form zu konfrontieren und voll Eigensinn neu zu vermitteln.
Aber all das sind letztlich nur Voraussetzungen. Am Ende steht das Gedicht ganz für sich, ganz vor denen, die das Buch aufschlagen, um zu lesen, und ich bleibe zurück, verwundert, in welche Winkel der Welt sich meine Gedichte entfernen und wo sie sich irgendwann verlieren werden.
«Einsichten - Aussichten» im September 2011: Remo Fasani
Kontakt
Schweizerische Nationalbibliothek
Schweizerisches Literaturarchiv
Hallwylstrasse 15
3003
Bern
Schweiz
Telefon
+41 58 462 92 58
Fax
+41 58 462 84 08